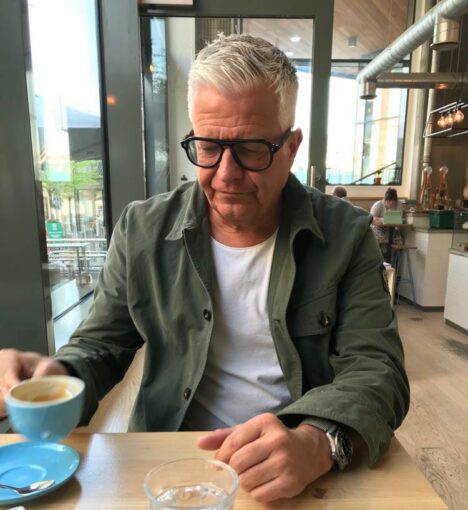Verzicht? Relativ. Eigenmotivation? In unserer DNA. Aber sind wir eine Art Ware?
Hockey meets Handball meets Fußball, Teil 1: Mitten in Deutschland trafen sich drei junge Athleten zum Meinungsaustausch. Schnell wurde klar: Sie eint nicht nur ihre Passion für den Sport. Auch die Probleme und Herausforderungen ihres dualen Lebens beschäftigen Julius Heyner, Dimitri Ignatow und Semir Kaymakci gleichermaßen.
Von Stefan Backs und Frank Schneller
[ALLGEMEIN | GESELLSCHAFT]
Euch eint, in Eurer Sportart besser zu sein als die meisten anderen. Ihr habt eine Profilaufbahn eingeschlagen. Von der klassischen Karriere hochrangiger Fußballprofis seid Ihr dennoch weit entfernt. Wie wichtig ist Euch das zweite Standbein, eine duale Karriereplanung?
Dimitri Ignatow: In der Rückbetrachtung sehr wichtig. Es fühlt sich gut an, eine Ausbildung abgeschlossen zu haben. Es gibt mir eine gewisse innere Sicherheit. Als ich noch jünger war, hat mich das nicht so interessiert. Ich wollte nach der Schule einfach nur Handball spielen – dass ich darin gut sein würde, zeichnete sich früh ab. Aber meine Familie und meine heutige Frau haben zum Glück nicht lockergelassen und mich von der Notwendigkeit einer Ausbildung überzeugt. Die hatten Weitblick. Nach vier nicht immer einfachen Jahren bin froh und stolz, es geschafft zu haben. Dank meiner Familie und der MT.
Semir Kaymakci: Für mich war es wichtig, mich nicht nur auf den Fußball zu verlassen, bei aller Leidenschaft für diesen Sport. Die Schule vernünftig hinter mich zu bringen stand nie zur Diskussion. Ich bin ein sehr bodenständiger Mensch, was auch an meinem Elternhaus liegt. In meiner jetzigen Situation kommt mir das entgegen. Mir stehen alle Wege offen, einen anderen Werdegang einzuschlagen. Ich bin froh, mein Abi in der Tasche zu haben, obwohl es nicht immer einfach war neben dem sportlichen Zeitplan.
Julius Hayner: Egal, wie sehr Du Deinen Sport liebst – in meinem Fall eben Hockey –, muss Dir ja klar sein, dass er nicht alles sein kann im Leben. Auch wirtschaftlich. Weder während der aktiven Laufbahn, ich bin ja kein hochklassiger Fußballprofi, noch nach der Karriere. Für mich gehörte es immer zusammen, mich im Sport und abseits des Sports weiterzuentwickeln und mir etwas aufzubauen. Ich studiere BWL und versuche, damit im Spätsommer fertig zu sein. Spätestens. Das Wörtchen ‚nebenbei‘ möchte ich bewusst nicht verwenden, das würde dem Studium nicht gerecht. Aber natürlich versuche ich diese beiden Laufbahnen so gut es geht aufeinander abzustimmen. Eine duale Karriereplanung ist ja im Hockey, Handball oder im Basketball eher die Regel.
Ein kleiner Junge hat wahrscheinlich Träume, aber noch keine Pläne. Wann in Eurem noch jungen Leben habt Ihr Euch bewusst für Leistungssport entschieden? Gab es den Moment, als Ihr merktet, es weit bringen zu können?
Ignatow: Das erste Mal darüber nachgedacht habe ich bei der ersten Einladung zur Junioren-Nationalmannschaft. Da wurde mir bewusst: Okay, ich bin auf meiner Position schon einer der besten Jungs hierzulande in meinem Jahrgang. Von da aus hat es sich entwickelt: Angefangen mit dem Angebot von Axel Renner zur MT zu kommen, über die ersten Einladungen, als Jugendlicher bei der ersten Mannschaft mit zu trainieren, bei der Zweiten zu spielen – das weckte den Glauben in mir, Handballprofi werden zu können.
Hayner: Diesen besonderen Moment gab es bei mir nicht. Das hat sich von klein auf alles entwickelt und verselbstständigt. Das ist nun mal das Selbstverständnis eines Sportlers: Wenn Training ansteht, ist einfach Training. Das wird dann einfach immer mehr. Wenn du besser bist, dann hast du noch Auswahl- und Zusatztraining. All das habe ich nie hinterfragt. Beim Training nicht pünktlich zu sein, gab’s nicht. Da musste dann als Teenager eben auch der Konfirmationsunterricht dran glauben, weil der sich 15 Minuten mit dem Training überschnitten hätte. Okay, einen besonderen Moment gab es doch: Mein erstes konkretes Ziel, die U21-WM in Indien. Einmal dort zu spielen, ist das Größte im Hockey. Da spielst du vor 25.000 Leuten, bist ein Superstar. Das war zurückblickend die unglaublichste Erfahrung meiner Sportkarriere. Dafür trainierst du dann natürlich nochmal härter.
Kaymakci: Bei mir war es von Anfang an klar, dass ich Profi werde. Ab dem Moment, also in der U12, wo ich meinen ersten kleinen Vertrag bei der SpVgg. Greuther Fürth unterschrieben habe. Da habe ich zu meinem Dad gesagt: Bitte fahr mich dorthin, ich werde zu 100% Profi, egal was passiert. Ich wäre ja sonst gar nicht dorthin gekommen. Dieses Selbstbewusstsein, Profi werden zu können, hatte ich unabhängig von manchen privaten wie sportlichen Höhen und Tiefen immer. Ich habe mit 16 das erste Mal bei den Profis trainiert, mit 16 auch das erste Mal Regionalliga gespielt. So nahm alles seinen Lauf.

Bei Dir hat sich inzwischen aber ein Sinneswandel eingestellt. Warum?
Kaymakci: Als Jugendspieler ist dir nicht bewusst, was es überhaupt heißt, Profi zu sein. Es ist einfach nur ein Begriff. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. In den älteren U-Mannschaften habe ich immer mehr Einblicke bekommen, wie das läuft. Dass es ein Geschäft ist. Ich habe das Profi-Dasein einige Zeit mitgemacht und mich dann entschieden, meine Fußball-Laufbahn vorerst zu beenden.
Und wie steht es mit all den Opfern, die man bringen muss? Den Verzicht, gerade im Hinblick darauf, dass man nicht ausgesorgt hat?
Hayner: Training ist Training und du planst dein Leben nach diesem Trainingsplan, nach dem Saisonplan – das stand für mich nie zur Debatte. Da braucht es keinen finanziellen Ansporn. Für mich ist es einfach die Selbstverständlichkeit des Sports, bis heute. Wenn du um sieben Uhr morgens im Regen Training hast, gehst du natürlich trotzdem hin. Wenn der Wecker klingelt, dann stehst du einfach auf.
Ignatow: Wir drei können sicher alle davon berichten, dass wir in der Jugend schon oft verzichten mussten, sei es auf Geburtstagspartys oder beim Weihnachtsessen. Ich weiß noch, dass ich mit der U-Nationalmannschaft immer ein Turnier vom 25.12. bis zum 5. Januar oder so hatte. Da gab es keine Zeit für Weihnachten. Mir war schon relativ früh klar, dass man viel trainieren musste, auch zwischen den Schulstunden, und dass man auf viel verzichtet – wobei wir den Begriff Verzicht sicher alle relativieren.
Kaymakci: Eigenmotivation ist wohl in unserer DNA. Wie Zähne putzen. Du machst das einfach. Du hinterfragst nicht, wann Training ist, sondern du guckst einfach auf den Plan. Du richtest alles nach dem Training. Du fragst dich nie: Gehe ich jetzt zum Geburtstag oder zum Training? Nein, du sagst: Ich habe Training. Als Kind denkst du noch nicht ans große Geld. Der Antrieb kommt woanders her. Aus dir selbst. Du willst einfach so gut und erfolgreich wie möglich sein.

Bei aller intrinsischer Motivation: Zu Begriffen wie ‚Verzicht‘ oder ‚Opfer bringen‘ – das klang schon an – habt Ihr eine andere Haltung …
Hayner: Genau. Es ist wie Semir und Dimitri sagen: Wer Sport auf relativ hohem Niveau betreibt, ist da anders geeicht. Der hat auch einen anderen Blick auf diese Begriffe als Nicht- oder Hobbysportler. Ich habe meinen Abiball verpasst, das war alternativlos. Natürlich gibt es schon Momente, vor allem im Umgang mit Freunden, die keinen Leistungssport betreiben, die wichtig sind – für die bin ich sehr dankbar. Mein Mitbewohner und bester Freund beispielsweise hat nichts mit Leistungssport zu tun – und das schätze ich sehr. Aber wenn der dann was aus seinem Leben erzählt, dann fragst du dich schon: wo ist das bei mir? Das sind ja schon auch prägende Momente in der sozialen Entwicklung. Ich habe beispielsweise aus Zeitgründen keinen echten Schulfreund gehabt. Du verpasst fast alles, was dieses Alter, zwischen 16 und 18 Jahren normalerweise prägt, weil der Rhythmus ein ganz anderer ist: Keine Partys, Keine Abendessen, keine Cafés. Auf der anderen Seite habe ich Dinge wie Indien erlebt oder deutsche Meisterschaften und alles was dazu gehört. Das lässt sich mit nichts aufwiegen – deswegen ist der Begriff Verzicht so schwer. Du verzichtest auf das eine, aber du kriegst halt auch ganz viel anderes geschenkt: Erfahrungen, Reisen, Emotionen, das Gemeinschaftsgefühl, das Erlebnis vor einer großen Kulisse zu spielen …
Ignatow: … stimmt: Wenn einem die Zuschauer zujubeln – das sind Glücksmomente, die andere so ja nicht erleben. Wovon man den Leuten nur erzählen kann. Nachempfinden können sie es vermutlich nicht. Wir haben uns letztes und dieses Jahr für das Final Four in Köln qualifiziert – in einer ausverkauften Lanxess Arena. So was kannte ich eigentlich nur aus dem Fernsehen – und dann bist du auf einmal selbst mittendrin. Die Leute jubeln dir zu, rufen deinen Namen – all das können andere nicht hautnah erleben. Aber, klar: die erzählen dir dann von Dingen, bei denen wir nicht so mitreden können, die für uns etwas Besonderes sind: Eine Silvesterparty beispielsweise. Es ist für mich auch wichtig, im Trainingslager mal mit einem Freund zu telefonieren, der nicht in der Handball-Blase ist, dich inhaltlich da mal kurz rausholt und davon berichtet, wie sein Tag als Lehrer war. Dem du einfach mal zuhören kannst.
Habt Ihr es schon mal bereut, und sei es nur kurz, die Profilaufbahn eingeschlagen zu haben? Naheliegend wäre das ja vor allem bei Semir …
Kaymakci: Nein, auf keinen Fall. Ich bereue grundsätzlich gar nichts in meinem Leben, weil ich glaube, dass mich alles, was ich erlebt habe, genau dorthin gebracht hat, wo ich jetzt eben bin und deswegen bin ich vielmehr unfassbar dankbar für alles, was ich in dieser Zeit erleben durfte. Weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich bin. Zu den Ansichten verholfen hat, die ich jetzt aktuell habe. Ich glaube, man muss immer mehr Opfer bringen, je höher es hinaufgeht. Wenn man nicht alles herausholt, gibt es einen, der das entscheidende Mal mehr oder härter trainiert. Nicht zuletzt auch schon im Jugendbereich. Und nachdem ich Profiluft geschnuppert habe, behaupte ich auch: Für Spieler, die nicht so extrem talentiert, aber die extrem ehrgeizig sind, ist es leichter, Profi zu werden, weil es – auch durch den gesellschaftlichen Wandel – einfach zu viele Leute gibt, die zu faul sind, um mehr zu investieren, mehr zu machen – von sich aus. Wer dazu bereit ist, erreicht letztlich mehr, selbst wenn ein paar Prozente Talent fehlen.
Hayner: Ich stimme Dir zu. Bei uns ist der Sport über die letzten zehn Jahre unfassbar athletisch geworden – viel physischer. Wo du vorher viel mehr Spieltalent hattest, hast du jetzt immer mehr Athletik. Das sind beispielsweise die Briten, die konnten nie gut Hockey spielen, die haben aber einfach wirklich Athletik, Athletik, Athletik gekloppt und gehören jetzt zur Weltspitze. Zurück zum Punkt des Bereuens: Nullkommanull. Es gibt Momente, in denen ich mich frage: was mache ich hier? Aber das ist wohl das Schicksal jeder Randsportart: Du bist wie gesagt in der Spitze deines Sports und einer der Besten in Deutschland und dann läufst du dich am 2. Januar um 18 Uhr bei Regen vor irgendeiner Halle in der Kälte warm, weil vorher noch die Handballer da trainieren. Das musst du erdulden – und dabei kann man schon mal aus dem Gleichgewicht geraten. In meiner Mannschaft spielt der weltbeste Hockeyspieler der letzten Jahre: Niklas Wellen. Der ist auch das Gesicht des Hockeys medial gewesen in den letzten Jahren. Großartiger Typ. Der arbeitet Vollzeit, ist Familienvater und solch ein Ausnahmesportler – aber auch er läuft am 2. Januar bei Wind und Wetter um 18 Uhr vor irgendeiner Schulhalle mit. Da denke ich mir: Okay, es könnte sich noch schlimmer anfühlen. Deswegen: Bereuen? Nein. Hinterfragen aber muss man manches, um sich selbst auch nicht zu ernst zu nehmen.
Ignatow: Würden wir etwas wirklich bereuen, würden wir es ja nicht machen. Dann hätten wir schon längst aufgehört oder uns was anderes gesucht. Klar, es gibt so Momente, in denen man halt einfach mal drüber nachdenkt und für sich abklärt, ob das der Weg ist, den man gehen möchte. Aber wenn man dann wie ich in der Halle steht und die Leute sieht, die man kennengelernt hat – bei uns kommen so viele Nationen zusammen, die voneinander lernen können, mit denen man sich verausgabt, lacht, nach dem Training ein Bierchen trinkt –, weiß man, wofür man den Aufwand betreibt. Man macht ja nicht nur Sport mit den Jungs, man lebt drum herum gewissermaßen auch mit ihnen, erfährt etwas über ihre Kultur, ihre Familien, man entwickelt mit ihnen ein soziales Netz, es entsteht eine Gemeinschaft – all das hat man im sogenannten normalen Leben nicht unbedingt. Das ist ein richtiger Vorteil: Der Teamgedanke, das Miteinander …

Die Sozialisierung im Mannschaftssport als Benefit …
Hayner: Für uns ja nicht besonders. Du gehst in die Kabine rein und interagierst mit den Leuten, kennst alle, weißt, wie du sie ansprichst, wer einen schlechten Tag, wer einen guten. Teamsport verleiht dir wichtige, wertvolle Skills, die jemand außerhalb des Sports nicht unbedingt hat. Ein ehemaliger Mitspieler von mir hat Schulungen gemacht im Rahmen von Personalberatung für Unternehmen. Er hat mir erzählt, was er da macht: Gruppenspiele, Interaktion, Führungsansprüche und -qualitäten. Ich habe gesagt: Aber das weiß doch jeder. Und er antwortete: Nein, das weiß nicht jeder. Da wurde mir klar: Wir haben das im Sport gelernt, wir sind so sozialisiert, aber andere Menschen lernen das nicht. Was wir im Sport mitbekommen, können wir auch ins echte Leben übertragen. Verhalten in der Gruppe, um bei dem Beispiel zu bleiben – vor allem, wenn dein Gegenüber auch Sportler ist. Da ist meistens direkt ein Draht, lockere Stimmung. Auch mehr Selbstbewusstsein durch den Umgang mit großen Persönlichkeiten. Man lernt auch etwas über Hierarchien.
Ignatow: Und man weiß auch, damit umzugehen. In dem Fitnessstudio, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, wusste ich direkt wie ich mit welchen Personen zu reden habe: Okay, der Chef ist so was wie mein Trainer, bei dem wahre ich Distanz. Wenn er sagt, du gehst jetzt runter ins Lager und machst da die Pakete auf, dann mache ich das. Aber wenn du mit anderen Mitarbeitern zu tun hast, also quasi mit deinen Mitspielern, sorge ich für lockere Stimmung, da ist auch mal ein Spruch drin. Ich stelle manchmal fest, dass Leute, die nicht im Sport aktiv sind und Teamverhalten nicht erleben, sich oft eingeengt fühlen und nicht wissen, wie sie mit den Leuten umgehen sollen. Das ist bei uns anders. Wir gehen einfach hin, geben uns die Hand, sagen: Jo, was geht. Und nach einer halben Stunde könnte ich sagen, die zwei sind meine besten Kumpels. Betretenes Schweigen gibt’s unter Sportlern nicht. Man findet immer was.
Kaymakci: Das, was du im Teamsport lernst, kannst du nirgendwo anders im Leben simulieren. Du triffst auch mal auf Leute, die du nicht magst. Aber du musst lernen, wenn du erfolgreich sein willst im Sinne der Mannschaft, mit jedem klarzukommen. Mit jedem eine Ebene zu finden. Wenn du irgendwen ausgrenzt, wirst du nicht weit kommen. Nur sind solche Prozesse oft nicht die Realität im Fußball.

Genau, denn bei allen Vorzügen reden wir hier über ein Leistungssystem: Zumindest im Fußball wird man dabei zur Ware. Der Verein verdient mit einem Geld. Man ist austauschbar. Wer nicht gut genug ist und nicht mehr den Profit bringt, wird rasiert. Wie empfindet Ihr das?
Kaymakci: Ich würde differenzieren zwischen Jugend und Profibereich – das Kabinenleben ist komplett anders, so habe ich es wahrgenommen, weil auch viel mehr Geld dahintersteckt. Ich bin überzeugt: Ein harmonisches Miteinander in der Kabine ist im Profifußball generell nicht mehr selbstverständlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es da noch harmonischer ist. Im Fußball sind falsch verstandener Konkurrenzkampf und Grüppchenbildungen signifikant. Das mit der Ware kann ich absolut bestätigen. Das ist ein Riesenproblem im Fußball. Man wird als Ware angesehen und hat daher auch oftmals nicht das Recht, Verantwortung zu übernehmen. Die Spieler, auch die jungen, sollen Verantwortung übernehmen, höre ich immer wieder. Nur entwickelt es sich komplett in die gegensätzliche Richtung. Jungen Spielern wird sie immer mehr weggenommen, auch wenn die Vereine etwas anderes propagieren. Es ist kein faires Geschäft.
Ignatow: Ich würde sagen, dass wir beim Handball noch nicht ganz an dem Punkt sind wie beim Fußball, dass wir uns aber immer mehr in diese Richtung bewegen, dass Spieler zur Ware werden. Wenn ich mit jüngeren Spielern rede, die mich nach Rat fragen, sage ich denen: versuch es dir einfach so vorzustellen, dass du eine Art Spielzeug bist. Und wenn der Chef, also der Sportdirektor, nicht mehr mit dir spielen will, dann tauscht er dich halt aus. Klingt jetzt krass, vielleicht etwas überspitzt, aber letztlich bin auch ich so was wie eine Ware – und wenn ich meine Leistung nicht bringe, kann ich in zwei Jahren hier weg sein und keiner hinterfragt, ob das jetzt die richtige Entscheidung war. Ich habe schon das Gefühl, dass Handball da dem Fußball immer ähnlicher wird – leider. Und wenn um unser Mitspracherecht geht: Ich finde auch, dass es gesund ist, wenn junge Spieler Verantwortung übernehmen. Ein dauerhafter Bonus für Erfahrung, wenn die Leistung nicht stimmt, wäre völlig falsch. Man muss sich die Meinung sagen dürfen, unabhängig von Hierarchien. Wenn das Team in der Kabine eine Einheit ist, ist das die halbe Miete.
Hayner: Dass wir zur Ware verkommen, kann ich nicht so teilen. Dafür ist Hockey dann wahrscheinlich einfach zu uninteressant in der breiten Öffentlichkeit. Bei Nationalmannschaftslehrgängen ist es ein wenig so, okay. Da wird zunächst ausschließlich auf Leistung geachtet, das erzeugt Drucksituationen. Und dabei kann das Gefühl der Austauschbarkeit entstehen. In meinem Verein war ich immer in der komfortablen Lage, dass ich eingewinkt werde in die Prozesse, nicht benutzt.
Ignatow: Im Fußball, Semir, dürfte es deswegen so schwierig sein, weil es dort einfach um viel mehr Geld geht. Dass Fußballer deshalb mehr Ich-AGs sind als wir. Vermutlich ist darum die Fluktuation im Fußball auch höher. Klar, haben wir auch die Möglichkeit zu wechseln, wenn uns irgendwas nicht passt, haben vielleicht die Chance, ein finanziell besseres Angebot zu bekommen. Das sind dann vielleicht 152 Euro Unterschied. Da lacht ja ein Fußballprofi drüber.